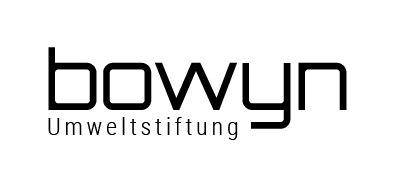Textilindustrie
Weltweit werden jährlich ca. 80Mrd. Kleidungsstücke verkauft und 80Mrd. landen auf dem Müll. Kunstfasern wie Polyester werden aus Erdöl hergestellt, für den konventionellen Baumwollanbau werden große Mengen Pestizide verwendet. Dadurch besteht beim Großkapital kein Interesse an anderen Materialien wie bspw. Hanf, der für den Anbau kaum Pestizide benötigt. Durch die Färbung und Veredelung von Textilien im Rahmen ihrer Herstellung werden schätzungsweise rund 20 Prozent der weltweiten Wasserverschmutzung verursacht.

Über Flüsse gelangen die Gifte ins Meer und ins Grundwasser. Schätzungen zufolge wurden in der weltweiten Textil- und Bekleidungsindustrie im Jahr 2015 79 Milliarden Kubikmeter Wasser verbraucht, während sich der Wasserverbrauch in der gesamten Wirtschaft der EU im Jahr 2017 auf 266 Milliarden Kubikmeter belief. Für die Herstellung eines einzigen T-Shirts aus Baumwolle werden schätzungsweise 2.700 Liter Süßwasser benötigt, was der Menge entspricht, die eine Person in 2,5 Jahren trinkt. Der Textilsektor war im Jahr 2020 die drittgrößte Quelle für Wasserverschmutzung und Flächenverbrauch.
Etwa 35 Prozent des primären Mikroplastiks, das in die Umwelt gelangt, hat seinen Ursprung im Waschen von synthetischen Textilien. Bei einer einzigen Wäsche von Polyesterkleidung können 700.000 Mikroplastikfasern freigesetzt werden, die dann in die Nahrungskette gelangen. Schon 2006 waren 70% der Flüsse und Seen in China zu stark belastet, um als Trinkwasser zu dienen. Ein Hauptverursacher ist die Textilindustrie. Es werden bromierte Flammschutzmittel (Hormoneingriff), Azofarbstoffe (können Krebs auslösen), zinnorganische Verbindungen (können das Immunsystem schädigen), perflourierte Chemikalien (können die Leber schädigen),Chlorbenzole und Lösungsmittel (schädigen das zentrale Nervensystem), Schwermetalle wie Cadmium, Quecksilber und Chrom (können Krebs erzeugen) verwendet.

Weltweit werden jährlich ca. 80Mrd. Kleidungsstücke verkauft und 80Mrd. landen auf dem Müll. Kunstfasern wie Polyester werden aus Erdöl hergestellt, für den konventionellen Baumwollanbau werden große Mengen Pestizide verwendet. Dadurch besteht beim Großkapital kein Interesse an anderen Materialien wie bspw. Hanf, der für den Anbau kaum Pestizide benötigt. Durch die Färbung und Veredelung von Textilien im Rahmen ihrer Herstellung werden schätzungsweise rund 20 Prozent der weltweiten Wasserverschmutzung verursacht.
Über Flüsse gelangen die Gifte ins Meer und ins Grundwasser. Schätzungen zufolge wurden in der weltweiten Textil- und Bekleidungsindustrie im Jahr 2015 79 Milliarden Kubikmeter Wasser verbraucht, während sich der Wasserverbrauch in der gesamten Wirtschaft der EU im Jahr 2017 auf 266 Milliarden Kubikmeter belief. Für die Herstellung eines einzigen T-Shirts aus Baumwolle werden schätzungsweise 2.700 Liter Süßwasser benötigt, was der Menge entspricht, die eine Person in 2,5 Jahren trinkt. Der Textilsektor war im Jahr 2020 die drittgrößte Quelle für Wasserverschmutzung und Flächenverbrauch.
Etwa 35 Prozent des primären Mikroplastiks, das in die Umwelt gelangt, hat seinen Ursprung im Waschen von synthetischen Textilien. Bei einer einzigen Wäsche von Polyesterkleidung können 700.000 Mikroplastikfasern freigesetzt werden, die dann in die Nahrungskette gelangen. Schon 2006 waren 70% der Flüsse und Seen in China zu stark belastet, um als Trinkwasser zu dienen. Ein Hauptverursacher ist die Textilindustrie. Es werden bromierte Flammschutzmittel (Hormoneingriff), Azofarbstoffe (können Krebs auslösen), zinnorganische Verbindungen (können das Immunsystem schädigen), perflourierte Chemikalien (können die Leber schädigen),Chlorbenzole und Lösungsmittel (schädigen das zentrale Nervensystem), Schwermetalle wie Cadmium, Quecksilber und Chrom (können Krebs erzeugen) verwendet.


Alle großen Marken haben die Produktion ausgelagert, um sich der Verantwortung zu entziehen. In Länden mit den geringsten Umweltauflagen und billigsten Arbeitskräften lässt man produzieren. Bangladesch ist nach China der zweitgrößte Textilproduzent und der größte Lederproduzent. Dhaka in Bangladesch ist die Nummer zwei der weltweit ungesündesten Städte und der Buriganga einer der am meisten verschmutzten Flüsse. 2/3 der Verschmutzung stammen aus Ledergerbereien.

Es gibt keine Möglichkeit, die Herkunft des Leders zu ermitteln. In Hazaribagh, einem Vorort von Dhaka gibt es 300 Gerbereien auf einem Gebiet von gerade mal 25ha. Über 14Mio Häute werden dort jährlich gegerbt. Als erstes werden die Häute mit Kalk bedeckt, abgespült und getrocknet. Ca. 300 Chemikalien wie Ammonium, Chrom, Säuren, Ethylen und Schwefelwasserstoff, viele ätzend werden verwendet. Zur Farbfixierung werden große Mengen an Quecksilber, besonders bei blau und schwarz benötigt. 90% der Arbeiter entwickeln dadurch Krankheiten. Täglich werden ca. 22.000 Kubikmeter giftiger Schlamm erzeugt, der Boden und Grundwasser kontaminiert.

Zwischen 2000 und 2015 hat sich die Bekleidungsproduktion verdoppelt, während die durchschnittliche Nutzungsdauer eines Kleidungsstücks gesunken ist. Ein Europäer kauft jedes Jahr durchschnittlich fast 26 Kilogramm Textilien und wirft etwa elf Kilogramm davon weg. Altkleider können in Länder außerhalb der EU exportiert werden, werden aber größtenteils (87 Prozent) verbrannt oder landen auf Deponien.
In der Atacama-Wüste in Chile bekommt man mittlerweile riesige bunte Kleiderberge zu sehen. Ein Ergebnis der weltweiten Überproduktion. Im Jahr 2021 kamen bis Oktober in der nahe gelegenen Freihandelszone von Iquique mehr als 29.000 Tonnen nicht verkaufter und gebrauchter Kleidung an. Die besten Stücke davon werden veräußert. Der Rest, etwa 40 Prozent, wird in der Wüste abgeladen. Schadstoffe in den Textilien belasten die Umwelt und bauen sich äußerst langsam ab oder hinterlassen Mikroplastik. Einige örtliche Unternehmen kämpfen gegen die Umweltverschmutzung an und recyceln die Altkleider zu Isoliermaterial.
FAST FASHION AUF REISEN: Kleider-Müllberge in der Atacama-Wüste
ARD @lpha 22.01.22




Alle großen Marken haben die Produktion ausgelagert, um sich der Verantwortung zu entziehen. In Länden mit den geringsten Umweltauflagen und billigsten Arbeitskräften lässt man produzieren. Bangladesch ist nach China der zweitgrößte Textilproduzent und der größte Lederproduzent. Dhaka in Bangladesch ist die Nummer zwei der weltweit ungesündesten Städte und der Buriganga einer der am meisten verschmutzten Flüsse. 2/3 der Verschmutzung stammen aus Ledergerbereien.
Es gibt keine Möglichkeit, die Herkunft des Leders zu ermitteln. In Hazaribagh, einem Vorort von Dhaka gibt es 300 Gerbereien auf einem Gebiet von gerade mal 25ha. Über 14Mio Häute werden dort jährlich gegerbt. Als erstes werden die Häute mit Kalk bedeckt, abgespült und getrocknet. Ca. 300 Chemikalien wie Ammonium, Chrom, Säuren, Ethylen und Schwefelwasserstoff, viele ätzend werden verwendet. Zur Farbfixierung werden große Mengen an Quecksilber, besonders bei blau und schwarz benötigt. 90% der Arbeiter entwickeln dadurch Krankheiten. Täglich werden ca. 22.000 Kubikmeter giftiger Schlamm erzeugt, der Boden und Grundwasser kontaminiert.
Zwischen 2000 und 2015 hat sich die Bekleidungsproduktion verdoppelt, während die durchschnittliche Nutzungsdauer eines Kleidungsstücks gesunken ist. Ein Europäer kauft jedes Jahr durchschnittlich fast 26 Kilogramm Textilien und wirft etwa elf Kilogramm davon weg. Altkleider können in Länder außerhalb der EU exportiert werden, werden aber größtenteils (87 Prozent) verbrannt oder landen auf Deponien.
In der Atacama-Wüste in Chile bekommt man mittlerweile riesige bunte Kleiderberge zu sehen. Ein Ergebnis der weltweiten Überproduktion. Im Jahr 2021 kamen bis Oktober in der nahe gelegenen Freihandelszone von Iquique mehr als 29.000 Tonnen nicht verkaufter und gebrauchter Kleidung an. Die besten Stücke davon werden veräußert. Der Rest, etwa 40 Prozent, wird in der Wüste abgeladen. Schadstoffe in den Textilien belasten die Umwelt und bauen sich äußerst langsam ab oder hinterlassen Mikroplastik. Einige örtliche Unternehmen kämpfen gegen die Umweltverschmutzung an und recyceln die Altkleider zu Isoliermaterial.
FAST FASHION AUF REISEN: Kleider-Müllberge in der Atacama-Wüste
ARD @lpha 22.01.22
Hersteller: Auftragsproduktion der großen Bekleidungsmarken in Ländern mit geringen Umweltstandards und billigen Löhnen
Auswirkungen: Umweltverschmutzung bei der Herstellung von Stoffen und Leder durch die Verwendung giftiger Materialien, die über Flüsse ins Meer gelangen oder direkt das Grundwasser kontaminieren. Bei den Kunststofffasern sind die Umweltauswirkungen durch das emittieren von Mikroplastik während des Gebrauchs noch gravierender.
Profiteure: Bei Kunststofffasern, durch die Verwendung großer Mengen Pestizide beim Baumwollanbau und chemischen Farben die Erdöl- und Chemieindustrie. Große Bekleidungsmarken und Handelshäuser, die billig produzieren lassen.
Ausblick: Verwendung nach Möglichkeit ausschließlich natürlicher Rohstoffe, die biologisch angebaut werden, leicht zu recyceln oder natürlich verrottbar sind. Kreislaufwirtschaft durch Recycling, Verbot von Kunststofffasern außer bei Funktionskleidung solange nicht biologisch ersetzbar
Quellen: „Vergiftete Flüsse“ David McIlvride
„Umweltauswirkungen von Textilproduktion und -abfällen“ EU Parlament 15.11.23
„Giftiges Leder Made in Bangladesch“ 2018 Elise Darblay und Eric de Lavarene
Bildnachweis: „Vergiftete Flüsse“ David McIlride, „Vergiftete Flüsse“ David McIlride, filmingindo.com, „Die schmutzigsten Flüsse der Welt“ n-tv, Antonio Cossio dpa, Yana Tatevosian iStock
Hersteller: Auftragsproduktion der großen Bekleidungsmarken in Ländern mit geringen Umweltstandards und billigen Löhnen
Auswirkungen: Umweltverschmutzung bei der Herstellung von Stoffen und Leder durch die Verwendung giftiger Materialien, die über Flüsse ins Meer gelangen oder direkt das Grundwasser kontaminieren. Bei den Kunststofffasern sind die Umweltauswirkungen durch das emittieren von Mikroplastik während des Gebrauchs noch gravierender.
Profiteure: Bei Kunststofffasern, durch die Verwendung großer Mengen Pestizide beim Baumwollanbau und chemischen Farben die Erdöl- und Chemieindustrie. Große Bekleidungsmarken und Handelshäuser, die billig produzieren lassen.
Ausblick: Verwendung nach Möglichkeit ausschließlich natürlicher Rohstoffe, die biologisch angebaut werden, leicht zu recyceln oder natürlich verrottbar sind. Kreislaufwirtschaft durch Recycling, Verbot von Kunststofffasern außer bei Funktionskleidung solange nicht biologisch ersetzbar.

Quellen: „Vergiftete Flüsse“ David McIlvride
„Umweltauswirkungen von Textilproduktion und -abfällen“ EU Parlament 15.11.23
„Giftiges Leder Made in Bangladesch“ 2018 Elise Darblay und Eric de Lavarene
Bildnachweis: „Vergiftete Flüsse“ David McIlvride, „Vergiftete Flüsse“ David McIlvride, filmingindo.com, „Die schmutzigsten Flüsse der Welt“ n-tv, Antonio Cossio dpa, Yana Tatevosian iStock